Auch wenn sie sich auf Twitter noch nicht zu äußern wagt. Elisabeth Noelle-Neumann formulierte in den 70er Jahren die Theorie der Schweigespirale. Danach hängt es in vielen Fällen von der wahrgenommenen Mehrheitsmeinung ab, ob sich Menschen öffentlich zu ihrer Meinung bekennen.
Auf Twitter war das Bild am Wahlabend klar: großes Entsetzen über die schwarz-gelbe Mehrheit, allgemeine Abscheu gegenüber der FDP. Dabei bin ich fast sicher, dass sich gerade auf Twitter überdurchschnittlich viele FDP-Wähler tummeln. Aber nur wenige von ihnen haben sich öffentlich geäußert, weil sie die Konfrontation mit der wahrgenommenen Mehrheit scheuten.
Es gibt ein neues liberales Milieu, das die Basis für den Wahlerfolg der FDP bildet. Und es ist gar nicht so weit entfernt von denen, die es Arbeit nennen. Gustav Seibt macht in der Süddeutschen Zeitung eine nicht unerhebliche neue Mitte aus.
Diese hätte früher selbstverständlich SPD oder Grüne gewählt. Heute aber ist sie vierteljährlich mit der Abrechnung der Umsatzsteuervoranmeldung beim Finanzamt beschäftigt. Viele kreative Berufe – Filmproduzenten, Webdesigner, Galeristen, etablierte Schauspieler – sind heute nicht mehr in Groß- und Staatsbetrieben wie Museen und Theatern beschäftigt. Stattdessen betreiben sie schnell entstehende wie vergehende kleine und mittlere Subunternehmen. Zwischen ihnen und dem Staat liegt keine Personalstelle mehr. Und so hat für sie das Wort „Transferleistung“ eine Anschaulichkeit, die da fehlt, wo man nur einmal im Monat achtlos einen Gehaltszettel abheftet.
Dass am unteren Rand dieses Kreativbürgertums die Zwangsverwaltung des Alltags durch die Arbeitsagenturen droht, macht die Einstellungen dieser Leute nicht sozialdemokratischer. Wer fast 20 Prozent Umsatzsteuer für jene öffentlich-rechtlichen Radiohonorare entrichtet, die von den öffentlich-rechtlichen Gebührenempfängern nicht vergütet werden, und wer einmal im Jahr die Bescheide der Künstlersozialkasse über die wahrscheinliche Rente ab 67 erhält, der schaut mit kühlem Blick auf die Rentnerheere bei den anderen Parteien.
Und so fort. Auch für die Piratenpartei, eigentlich eine Art FDP 2.0, hat Seibt eine passende Erklärung parat:
Übrigens mag es sein, dass die Piratenpartei bald den Prekariatsflügel dieses volatilen intellektuellen Unternehmertums darstellt. Und auch das hat nicht nur einen kulturellen Hintergrund, geht es doch um Zugangs- und Verwertungsrechte im Hauptarbeitsfeld dieser Schicht: dem Internet. Und um jene bürgerliche Freiheit sowieso, die den alten Staatsvolksparteien immer öfter weniger bedeutet als die Sicherheit. In diesem Milieu, das wachsen wird, will man sich weder von der Arbeitsagentur das Leben vorschreiben noch vom Staatsschutz durchleuchten lassen.
Dieser Freiheitswille, er hieß einmal Liberalismus.
Die Piratenpartei und mit ihr die lautstarke Mehrheit auf Twitter sitzen vorerst in ihrer Nische fest, als Minderheiten, die sie tatsächlich sind. Denn wie Christoph Salzig treffend bemerkt:
Die Selbstwahrnehmung der Anhänger und einiger Piraten selbst und die erzielte Wirkung stehen in einem dissonanten Verhältnis. Hierzu gibt es in der Marketing-, Werbe- und PR-Welt leider einige unübersehbare Parallelen. Nicht umsonst werden die zum Teile ebenso zaghaften wie untauglichen ersten Schritte einzelner Unternehmen, sich in Web 2.0 (allein, dass dieses Wort aus dem Sprachgebrauch der so genannten Social Media Evangelisten bereits getilgt wurde, spricht Bände) zu versuchen, mit einer Urgewalt gebrandmarkt, dass man den Eindruck gewinnen kann, das Ende des Word Wide Web steht bevor.
Doch die Wahrheit sieht anders aus. Während bisweilen für mehrere Tage (darauf beschränken sich derartige Diskussionen zum Glück) in der Social Media Nische kaum noch andere Themen gehandelt werden, nimmt die „große, weite Welt“ da draußen, kaum Notiz. Nicht allein Vodafone-Sprecher Kuzey Alexander Esener konstatierte, dass der vom „Mikrokosmos“ ausgelöste Social Media „Tsunami“ sich in den Filialen überhaupt nicht ausgewirkt hat. Ein wenig mehr Bodenständigkeit stünde vielen Protagonisten gut zu Gesicht. Das würde das Verständnis für die eigenen Ansichten und dringend notwendige Richtungswechsel in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik substanziell fördern.


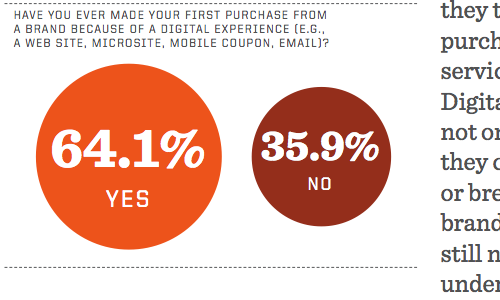

![Reblog this post [with Zemanta]](http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=081666f3-c5b7-419f-96cc-76a15f0932eb)
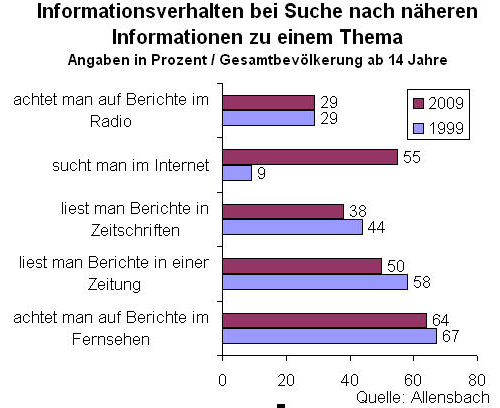
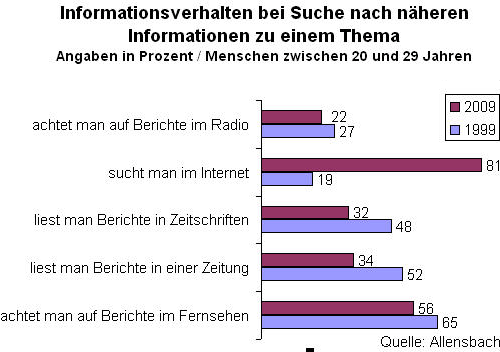
![Reblog this post [with Zemanta]](http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=39f8354d-71cc-44cf-bef0-d87858a42d0b)


![Reblog this post [with Zemanta]](http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=c23c51d5-c617-4c52-986d-223171fa5fd1)
![Reblog this post [with Zemanta]](http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=6f98e12d-e019-4cd0-b890-d2f3d04f90d5)

