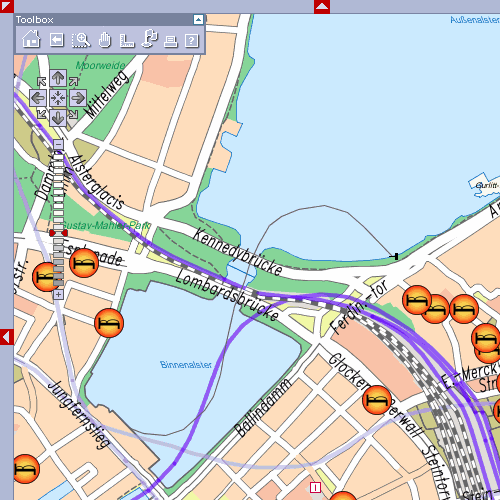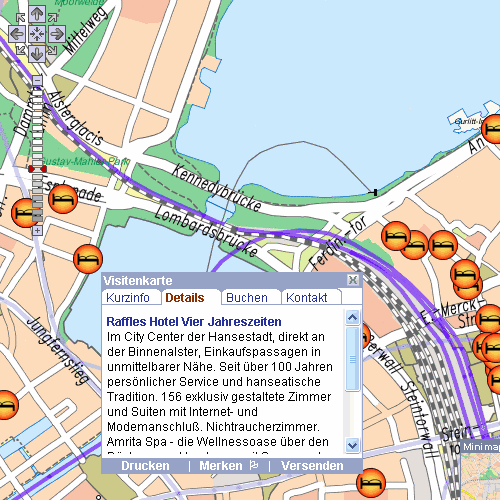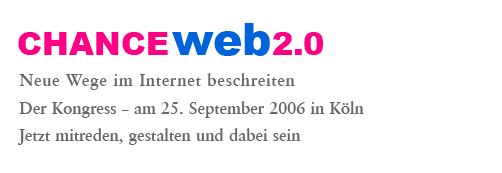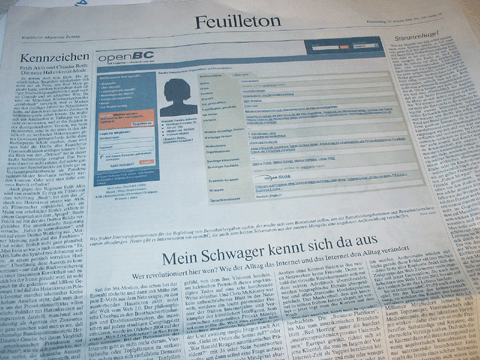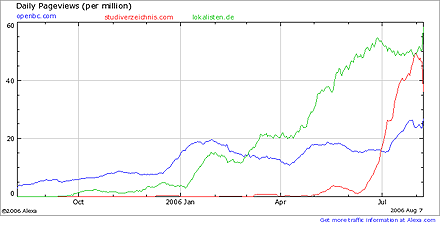Wie Ajax die Praxis verändert, hat Hendrike Heydenreich, Frontend-Spezialistin bei SinnerSchrader Neue Informatik, in einem Gastbeitrag für die Computerwoche beschrieben. Ein Auszug:
Ajax ist bisher vor allem in Verbindung mit Web-2.0-Websites intensiv eingesetzt worden. Vorreiter beim Einsatz dieser Technik sind (häufig sehr kleine) innovative Internet-Unternehmen und Startups. Die Entwicklung der entsprechenden Anwendungen ist durch Geschwindigkeit und Pragmatismus in einem kleinen Team von Spezialisten geprägt, die sich schnell und informell austauschen können. Häufig sind es sogar dieselben Personen, die die fachlichen Anforderungen definieren und diese auch umsetzen. In der Literatur werden solche Entwicklungsprozesse als „agile Programmierung“ bezeichnet: Iterative Entwicklungsmethoden werden verwendet, um schnell prototypische Ergebnisse zu schaffen und diese kontinuierlich zu verbessern. Es ist auffällig, dass viele Web-2.0-Anwendungen das Betastadium bewusst nicht verlassen.
So wirkungsvoll diese Arbeitsmethoden für den oben beschriebenen Einsatz auch sein mögen, für die Entwicklung von unternehmensinternen Anwendungen oder Internet-Präsenzen großer Unternehmen sind sie nicht ohne weiteres geeignet. Hier gilt es neben der Einführung neuer Funktionen auch Sicherheit in Bezug auf die Erfüllung fachlicher Anforderungen sowie auf die Einhaltung von Kostenrahmen und Zeitplänen zu gewährleisten. Nicht selten müssen Funktionen und Technik auch mit verschiedenen Stakeholdern abgestimmt werden. An der Erstellung eines – zumindest groben – Konzepts führt daher kein Weg vorbei, auch wenn das klassische Wasserfallmodell mit Grobkonzept, Feinspezifikation und Implementierung sicher nicht optimal zur Entwicklung von Ajax-Anwendungen geeignet ist.
Wie kann nun Ajax unter Nutzung eines konventionellen Entwicklungsprozesses, wie er in den meisten Projekten im professionellen Umfeld vorgegeben ist, eingesetzt werden? Bei Ajax handelt es sich um eine Technik, bei der die technischen und fachlichen Aspekte eng und beinahe untrennbar miteinander verbunden werden. Bei der Konzeption wird daher weder ein allein fachlich getriebener Berater noch ein reiner Techniker zu den gewünschten Ergebnissen kommen. Stattdessen ist eine neue Rolle gefordert: der User-Interface-Designer. Dabei handelt es sich um eine Person, die die fachlichen Aspekte der Nutzerführung ebenso versteht wie die Aspekte der technischen Umsetzung.
Idealerweise ist diese Person auch in der Lage, einfache Anwendungen selbst zu entwickeln und somit während der Konzeption kleinere Prototypen zu erstellen. Solche Prototypen haben sich als extrem wichtig und hilfreich erwiesen. Sie schaffen nicht nur Sicherheit in Bezug auf die Erfüllung der fachlichen Anforderungen, sondern gestatten auch erste Tests bezüglich des Verhaltens der Anwendung unter verschiedenen Bedingungen, zum Beispiel bei verschiedenen Bandbreiten oder Bildschirmauflösungen. Diese Prototypen lassen sich dann entweder direkt als Teil der Anforderungsdefinition verwenden (fachlich und technisch), oder die Eigenschaften des Prototyps werden noch einmal, wie gewohnt, schriftlich dokumentiert. Dabei folgt hier die formale Dokumentation dem getesteten und funktionierenden Konzept und nicht umgekehrt – eine Erfahrung aus dem fulminanten Erfolg der Web-2.0-Projekte.
Den ganzen Artikel gibt es in Heft 33/2006, erschienen am 18. August.