I have cancer, prostate cancer.
So lakonisch notierte Jeff Jarvis im August seine Krebsdiagnose. Und es blieb nicht bei diesem einfachen Faktum. Jeff schilderte die Krankheit, seine Behandlung und deren Folgen in allen Details, auch den intimsten. Für ihn war diese radikale Offenheit das Ergebnis einer einfachen Abwägung: Durch seine Offenheit und Öffentlichkeit hat er mehr zu gewinnen als zu verlieren.
Das umgekehrte Argument stammt von Google-Chef Eric Schmidt und weist in die gleiche Richtung:
If you have something that you don’t want anyone to know, maybe you shouldn’t be doing it in the first place.
Christian Stöcker hat aus diesem einfachen Satz eine umfangreiche Verschwörungstheorie gestrickt und diagnostiziert, Google wolle die Weltherrschaft. Das Wort Marktführerschaft war ihm wohl nicht stark genug.
Doch Wissen ist Macht. So ist die Frage, ob die Mission von Google – to organize the world’s information and make it universally accessible and useful – synonym für Weltherrschaft steht. Hat, wer die Informationen der ganzen Welt organisiert, allgemein zugänglich und nützlich macht, am Ende die Weltherrschaft? Markus Breuer zeigt ausführlich, was der Schmidt-Satz, weniger reißerisch interpretiert, auch bedeuten kann.
Tatsächlich hat das Internet am Ende seiner ersten vollen Dekade immense Auswirkungen auf das bürgerliche Konzept der Privatsphäre, das in Deutschland besonders stark ist. Wir selbst geben immer mehr persönliche, private Daten ins öffentliche Netz, weil wir uns davon, wie Jeff Jarvis, mehr Nutzen, Spaß oder Gewinn versprechen als wenn wir sie für uns behalten würden. Das ist durchaus vereinbar mit dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, wie es das Bundesverfassungsgericht in seinem Volkszählungsurteil von 1983 definiert hat. Die Älteren unter uns werden sich erinnern.
Und es ist durchaus nicht so, dass es keine abgestuften Freigaben und Sicherheitsstufen gäbe. Der Einzelne hat nicht nur die Wahl zwischen Schwarz und Weiß, zwischen öffentlichen oder privaten Daten, im Netz frei verfügbar oder gar nicht im Netz. Im Gegenteil hat er so viele Wahlmöglichkeiten, dass ihn womöglich schon deren Vielzahl überfordert wie Frank Schirrmacher das Netz insgesamt. Aber es gibt durch Öffentlichkeit mehr zu gewinnen als zu verlieren.
Reste des alten, bürgerlichen Konzepts von Privatsphäre scheinen sogar noch bei Sascha Lobos Replik auf Schirrmacher durch, wenn er schreibt:
Erklären wir, weshalb wir seltsame Fotos von uns ins Netz stellen und trotzdem erwarten, dass unsere zukünftigen Arbeitgeber nicht in diesen manchmal öffentlich zugänglichen, aber privaten Daten herumschnüffeln. Es würde ja auch niemand gern bei einer Firma arbeiten, die den Hausmüll eines Bewerbers durchwühlt, selbst wenn die Tonne vor der Tür steht.
Öffentlich zugänglich, aber privat – ist das nicht ein Widerspruch in sich? Vielleicht. Jedenfalls stehen wir, wie Markus Breuer treffend diagnostiziert, vor einem kulturellen Wandel, der die Verhältnisse von Geheimnissen und Privatsphäre gründlich ändern wird.
Dass das uns, die wir in einer anderen Kultur von Heimlichkeit und „privacy“ aufgewachsen sind, nicht gefallen muss, liegt auf der Hand. Das ändert nichts daran, dass es so kommen wird – und sich die Gesellschaft daran gewöhnen und anpassen wird. Im Zeitalter des Internets ist es sehr, sehr, sehr schwierig, Geheimnisse zu bewahren. Das gilt so für „den kleinen Mann“, aber auch für die Mächtigen dieser Welt. Gerade Letztere mussten das in den letzten Jahren immer wieder einmal merken. Und tatsächlich sehe ich da nicht nur ein „Ausspähen“, sondern auch eine wachsende Transparenz, die viele gute Seiten hat. Es kommt halt immer auf den Betrachtungswinkel an.
Transparenz ist das Gebot der neuen Zeit.

![Reblog this post [with Zemanta]](http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=0eeebda4-27c9-448c-bd7a-757550eb3450)
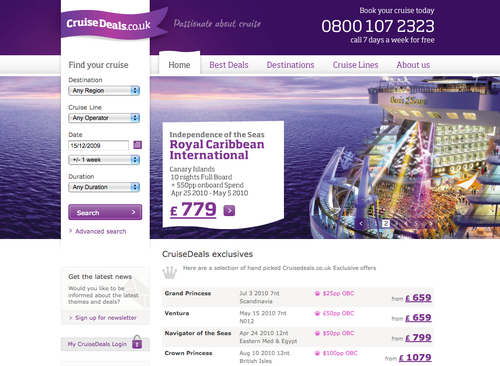
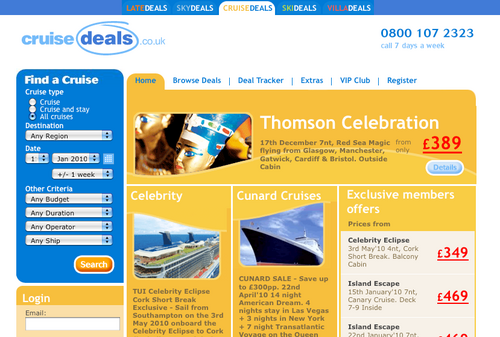
![Reblog this post [with Zemanta]](http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=a0e3487a-43cc-4cd8-a73d-367aeeef0ac5)
![Reblog this post [with Zemanta]](http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=9940f0d7-c4e7-42ec-9a5a-6dcc2043c305)
![Reblog this post [with Zemanta]](http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=49f55ea4-86ce-425e-b207-f088d4e92474)

