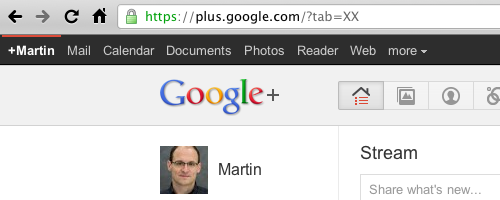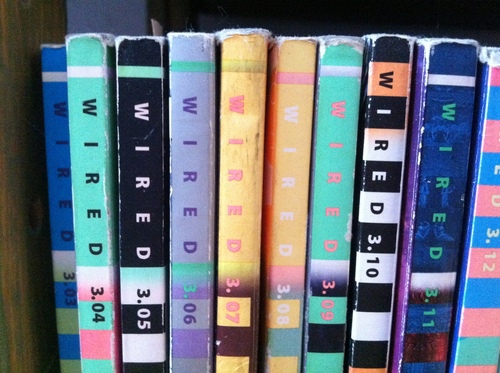Social war gestern. Jetzt geht es um die Identität der Konsumenten, und morgen um ihre Bankkonten. Die vier apokalyptischen Reiter des Internets – Amazon, Apple, Facebook und Google – liefern sich derzeit eine Schlacht um die Nutzerkonten, die bald schon in einen Kampf um die Girokonten münden könnte.
Deshalb sind bei Google+ keine anonymen Nutzerkonten möglich – wie bei Amazon und Apple übrigens, und auch Facebook erlaubt keine Pseudonyme oder anonyme Accounts (obwohl das in der Praxis bis jetzt nicht strikt durchgesetzt wird). Google+ ist mehr als nur ein Social Network oder die Antwort auf Facebook – es ist Googles Identitätsdienst, künftig Personalausweis und Kreditkarte zugleich.
Wie wir künftig im Netz – und nicht nur dort, sondern auch in der physischen Welt – bezahlen, hinter dieser Frage steckt buchstäblich jede Menge Geld. Wenn ich mein Girokonto erst einmal bei Amazon, Apple, Facebook oder Google habe, dann können Bezahlvorgänge im Netz ohne Beteiligung des herkömmlichen Bankensystems stattfinden.
Recht weit vorne in diesem Rennen liegt übrigens Paypal, das in Europa bereits eine Bank ist und über ein Jahrzehnt Erfahrung mit Zahlungsprozessen hat. Interessanterweise gehört Paypal nicht zu einem der Großen Vier, sondern zu Ebay, und ist deshalb etwas aus dem Fokus geraten. Holger Spielberg von Paypal hat auf der NEXT11 einen guten Überblick über diesen spannenden Markt gegeben.
Amazon hat von je her Zahlungsdaten seiner Kunden, bietet schon länger eine eigene Kreditkarte an und führt bereits Guthaben, bis jetzt in Form von Gutscheinen. Jüngstes Beispiel ist das Trade-In-Programm für den Ankauf gebrauchter Ware gegen Amazon-Guthaben.
Apple nimmt sich im Vergleich dazu recht spartanisch aus: Ohne Kredit- oder Guthabenkarte geht nichts. Was umgekehrt aber bedeutet, dass mit jedem Apple-Konto ein Zahlungsweg verbunden ist. Und Facebook hat längst eine eigene Währung, mit der ich früher oder später auch anderswo im Netz (oder gar in der physischen Welt, mit meinem Facebook Phone) werde bezahlen können.
Eins ist klar: Google Wallet ist nur der Anfang. Die vier Musketiere werden sich früher oder später im Wettbewerb mit den etablierten, krisengeschüttelten Banken wiederfinden. Die Finanzbranche ist längst reif für die digitale Revolution. Chris Skinner sieht die Reformation im Bankensektor bereits am Horizont.
Chris Skinner hält nächste Woche die Keynote auf der ersten NEXT Finance in Frankfurt/Main. Sein Thema: Why Banking Will Disappear But Banks Will Not … Well, Not All of Them. Übrigens die Antithese zu einer berühmten Sentenz von Bill Gates: Banking is necessary, banks are not.
[via]
Nachtrag: Thilo Specht schreibt heute praktisch gleichzeitig (und als Antwort auf Wolfgang Lünenbürger-Reidenbachs Todesprognose für Facebook):
Facebook hat nicht nur über 700 Millionen Datensätze, sondern über 700 Millionen Kunden. Man stelle sich vor, das Unternehmen erwirbt eine Banklizenz und bietet seinen Bestandskunden (Online-)Banking- und Investment-Produkte an. Auf der Grundlage von Markt- UND Netzwerkeigenen Daten. Inklusive sicherer Bezahlmöglichkeiten in den großen Shops wie Amazon, eBay und Co. (Tschüss Paypal, ich kann mir Deine Passwörter sowieso nie merken). Direktüberweisungen direkt aus dem Profil heraus, an das Profil eines anderen Mitglieds. Mobile Payment. Hört ihr sie rascheln, die Scheinchen? Die Facebook International Bank kann global agieren, weil sie schon überall vor Ort ist. Weil die Kunden schon alle an Bord sind. Weil die Investmentprojekte schon alle Facebook-Seiten haben. Weil die Infrastruktur schon steht.