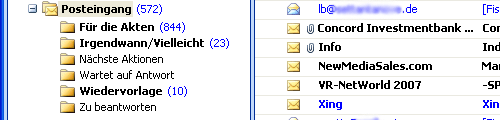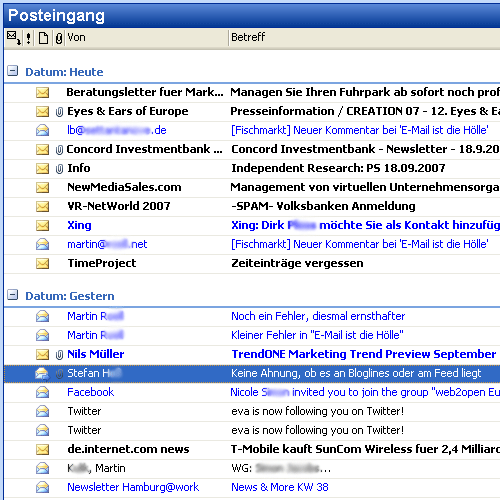Es gibt Themen, die bleiben, und Diskussionen, die immer wieder und immer neu geführt werden müssen. Schön, wenn es auch Diskutanten gibt, die lange genug dabei sind, um daraus zu lernen. Die Gespräche über die großen Trends und Themen des Web bleiben, nur die Gesprächspartner wechseln und die Erkenntnis schreitet voran.
Nicholas Negroponte schrieb 1995 in Being Digital: „Computing is not about computers any more. It is about living.“ David Weinberger variiert seit Cluetrain Manifesto (1999) und Small Pieces Loosely Joined (2002) sein Thema, das da lautet: Wie verändert das Web das Marketing, die Wirtschaft und die Welt insgesamt?
Mit Everything is Miscellaneous hat er jüngst ein weiteres Buch hinzugefügt. Es ist eine Art Being Digital 2.0. Im Vorwort schreibt er:
The physical limitations that silently guide the organization of an office supply store also guide how we organize our businesses, our government, our schools. They have guided–and limited–how we organize knowledge itself. From management structures to encyclopedias, to the courses of study we put our children through, to the way we decide what’s worth believing, we have organized our ideas with principles designed for use in a world limited by the laws of physics. Suppose that now, for the first time in history, we are able to arrange our concepts without the silent limitations of the physical. How might our ideas, organizations, and knowledge itself change?
Seine Antwort gab David Weinberger heute in Form einer Keynote auf der Picnic im Amsterdam zu Protokoll. Große Teile davon hat Bruno Giussani notiert.
Als Gegenstück zu Weinberger hat die schlaue Kongressleitung die Rolle des bad guy mit Andrew Keen besetzt und zwischen die beiden den alten Fuchs Walt Mossberg als Moderator gesetzt. Mossberg steht als Technologieredakteur des Wall Street Journal und Gastgeber der Konferenz All Things Digital gut im Stoff und neigt als Vertreter der alten Medien eher Keen zu denn Weinberger.
So kommt nach dessen programmatischer Rede eine lebhafte Diskussion in Gang. Denn auch Keen hat ein Buch zu verkaufen: The Cult of the Amateur heißt es, und Keen profiliert sich damit als Kritiker mindestens der Version 2.0 des Web, im Grunde aber passt ihm die ganze Richtung nicht.
Weinberger weist zu Recht darauf hin, dass die tragenden Prinzipien des Web auch schon Tim Berners-Lee bewegt haben, als er das Hyperlink-Konzept so bestechend einfach und erfolgreich implementierte. Es ging im Web von Anfang an darum, den Daten Bedeutung zu geben. Der blau geschriebene, unterstrichene Klartext eines Hyperlinks (Web 1.0) oder das Etikett, das Tag (Web 2.0) sind im Prinzip frei wählbare Metadaten, die den Daten Bedeutung verleihen.
Keen und Mossberg betrachten das Web eher als ein Massenmedium und kommen deshalb zu den sattsam bekannten Beobachtungen, die aus dieser Perspektive entstehen müssen. Dann erscheint die Wikipedia mit ihrer Faktenfülle und den offen sichtbaren Baustellen plötzlich als überkomplex.
Das Web macht die Dinge komplizierter, nicht einfacher. Es spiegelt die Komplexität der übrigen Welt. Darin sind sich alle drei einig. Weinberger hält das für einen Vorteil und für den Reiz des Web, Keen und Mossberg hingegen sehen hier eher ein Problem.